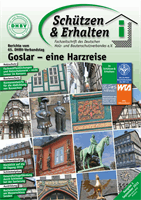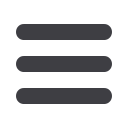
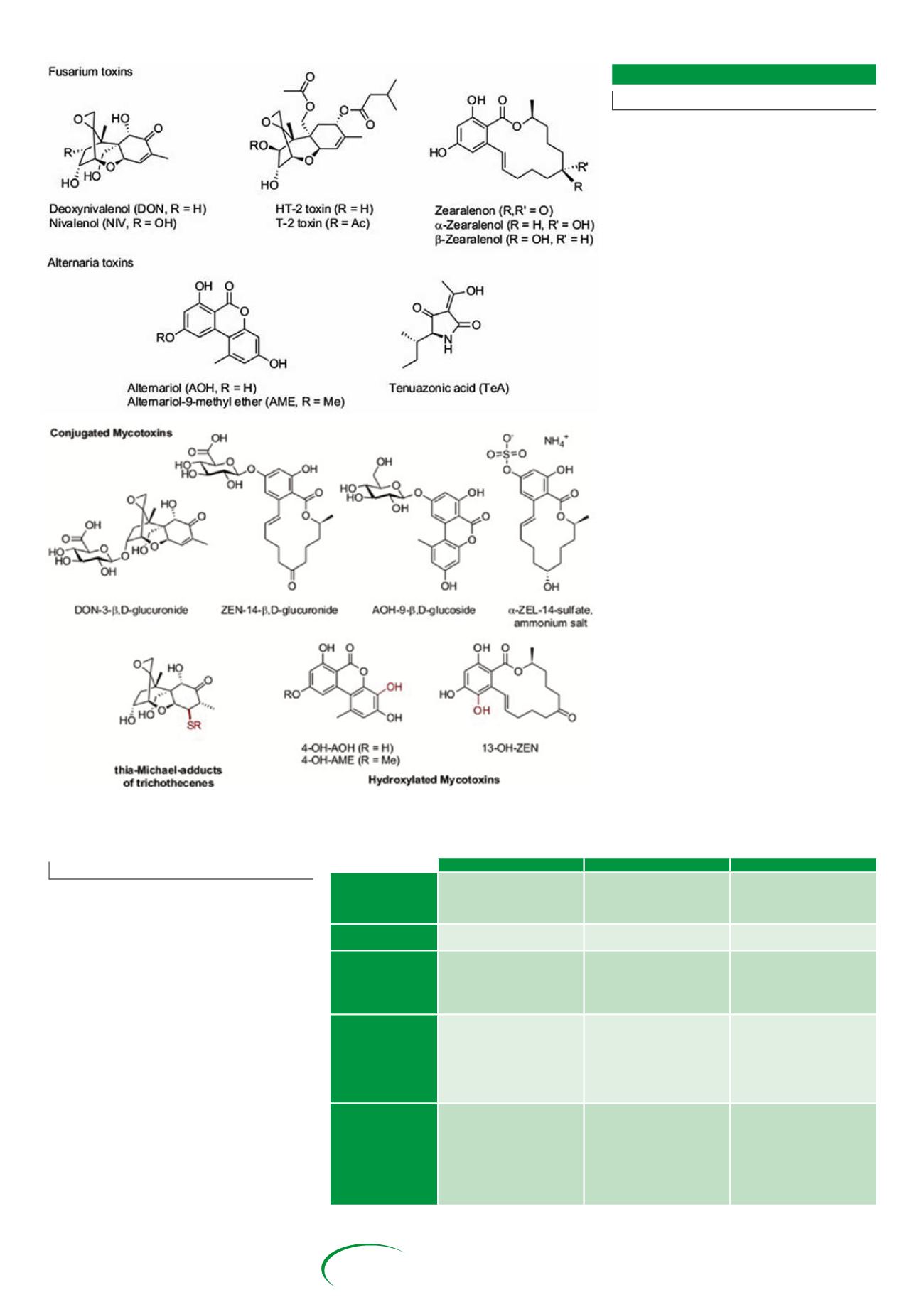
Sensibilisierung und Allergien
Was oftmals als Weicheierei abgetan wird,
sind die sog. Befindlichkeitsstörungen. Das sind
z. T. unspezifische Körperreaktionen auf nicht-
toxische und nichtinfektiöse Belastungen, die
auch auf psychischen Wege Erkrankungserschei-
nungen auslösen können. Dazu zählen Gerüche,
die als Belästigung empfunden werden oder auch
Ekelgefühle, die dauerhaft zu einer Störung der
Gesundheit führen können. Dazu muss es sich
nicht im eigentlichen Sinne um gefährdende
Stoffe handeln (7).
Beim Kontakt mit Schimmelpilzen, Bakterien
oder Milbenkot kann es zudem zu einer Sensi-
bilisierung kommen, d. h. der Körper wird nach
einem Erstkontakt mit dem Allergen in erhöhte
Abwehrbereitschaft versetzt und merkt sich
diesen Zustand. Allerdings so, dass daraus eine
fehlgeleitete spezifische Immunantwort aufge-
baut wird. Bei einem erneuten Kontakt kann es
dann zu einer allergischen Reaktion kommen,
die sich unmerklich oder auch bis hin zum al
lergischen Schock manifestieren kann. Um sen-
sibilisiert zu werden, muss der Körper also ein
erstes Mal die Spore oder Pilzbestandteile als
Feindbild ausmachen. Im Nachhinein ist nicht
auszumachen, wann denn dieser so wichtige
Erstkontakt stattgefunden hat. Es kann beim
ersten Kontakt mit einer Spore passiert sein,
aber auch beim zehnten oder hundertsten Kon-
takt. Auch äußere Einflüsse oder Stress können
den Erstkontakt begünstigen. Daraus kann man
schon mal ableiten, dass diejenigen, die häufig
mit Schimmelpilzen zu tun haben, gute Chan-
cen auf den auslösenden Erstkontakt haben. Hat
man sich erarbeitet, quasi.
Hat eine Sensibilisierung stattgefunden, kann
im Folgenden eine Allergie entwickelt werden.
Eine Allergie ist eine Immunreaktion des Körpers
auf nicht-infektiöse Fremdstoffe (Antigene bzw.
Allergene). Der Körper reagiert mit Entzündungs-
zeichen und der Bildung von Antikörpern (An-
tigen-Antikörper-Reaktion). Eine Allergie kann
sich in Form von leichten Hautausschlägen, aber
auch in lebensbedrohlichen Reaktionen manife-
stieren (anaphylaktische allergische Reaktion).
Allergien können in 4 Typen auftreten. Da-
von sind im Wesentlichen die Typen I, III und
selten IV bei Schimmel- und Feuchteschäden
relevant. Die Typ-I-Allergie wird auch als Aller-
gie vom Soforttyp bezeichnet und ist die häu-
figste Allergieform. Innerhalb von Sekunden
oder Minuten tritt die allergische Reaktion ein.
Typisches Beispiel für diesen Allergie-Typ ist das
allergische Asthma. Die Typ-III-Allergie nennt
man auch Immunkomplex-Typ oder
Arthus-Typ.
Hier bilden sich innerhalb von Stunden Immun-
komplexe von Antikörpern und Antigenen, die
allergische Reaktion tritt um Stunden verzö-
gert ein. Typisches Beispiel hierfür ist die sog.
Farmer-Lunge. Bei der Typ-IV-Allergie (Spättyp)
führen sensibilisierte T-Lymphozyten erst nach
Stunden bis Tagen zu Entzündungsreaktionen,
die auf den Ort des Allergens beschränkt sind.
Fachbereiche
Schimmelpilze
Infektion
Intoxikation
Allergie
Definition
Invasiver Befall von
Organen
Vergiftung durch Stoff-
wechselprodukte
Fehlgeleitete Immun
reaktion auf nichttoxische
oder nichtinfektiöse
Bestandteile
Verursacht durch
Lebensfähige Sporen und
Zellen
Mycotoxine
Alle Bestandteile
Voraussetzung
– vitale Zellen notwendig
– Immunsuppression
– Eintrittspforte
– Mindestkonzentrationen
– Aufnahmepfad oral oder
dermal
– Vitalität nicht notwen-
dig
– auslösendes Moment
Sensibilisierung not
wendig
Folgen für den
Organismus
– Wachstum innerhalb des
Gewebes mit schlechter
Prognose (letaler Aus-
gang)
– Lokal beschränkte
nichtinvasive Befalls
herde ohne Effekte
– Zellschäden
– Fruchtschäden
– Schäden am ZNS
– Schäden an DNS
– Enzymblockaden
– Letaler Ausgang möglich
– heuschnupfenartige
Symptome
– EAA
– MMI
– anaphylaktischer Schock
Gefährdete
Personen bei
Schimmelschäden
– Immunsupprimierte
– Frühchen
– Kinder mit Mukovis
zidose
– bei Schimmelschäden
im Innenraum unwahr
scheinlich
– bei Sanierungsmaßnah-
men zu berücksichtigen
(ODTS)
– abhängig von der
Exposition, Konstitution
können alle Personen-
gruppen sensibilisiert
werden
– insbesondere Sanierer
und im beruflichen
Umfeld (EAA)
Schützen & Erhalten · September 2015 · Seite 26
Bild 1: Strukturformeln diverser Mykotoxine, die sehr viel häufiger als Kontaminanten in Lebensmitteln
auftreten, als dass sie im Schimmelschaden in Erscheinung treten. (Homepage des Instituts für angewandte
Biochemie der Technischen Universität Wien)
Tabelle 2: Zusammenfassende Darstellung möglicher Gesundheitsgefährdungen durch Schimmelpilze