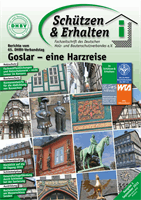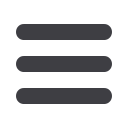
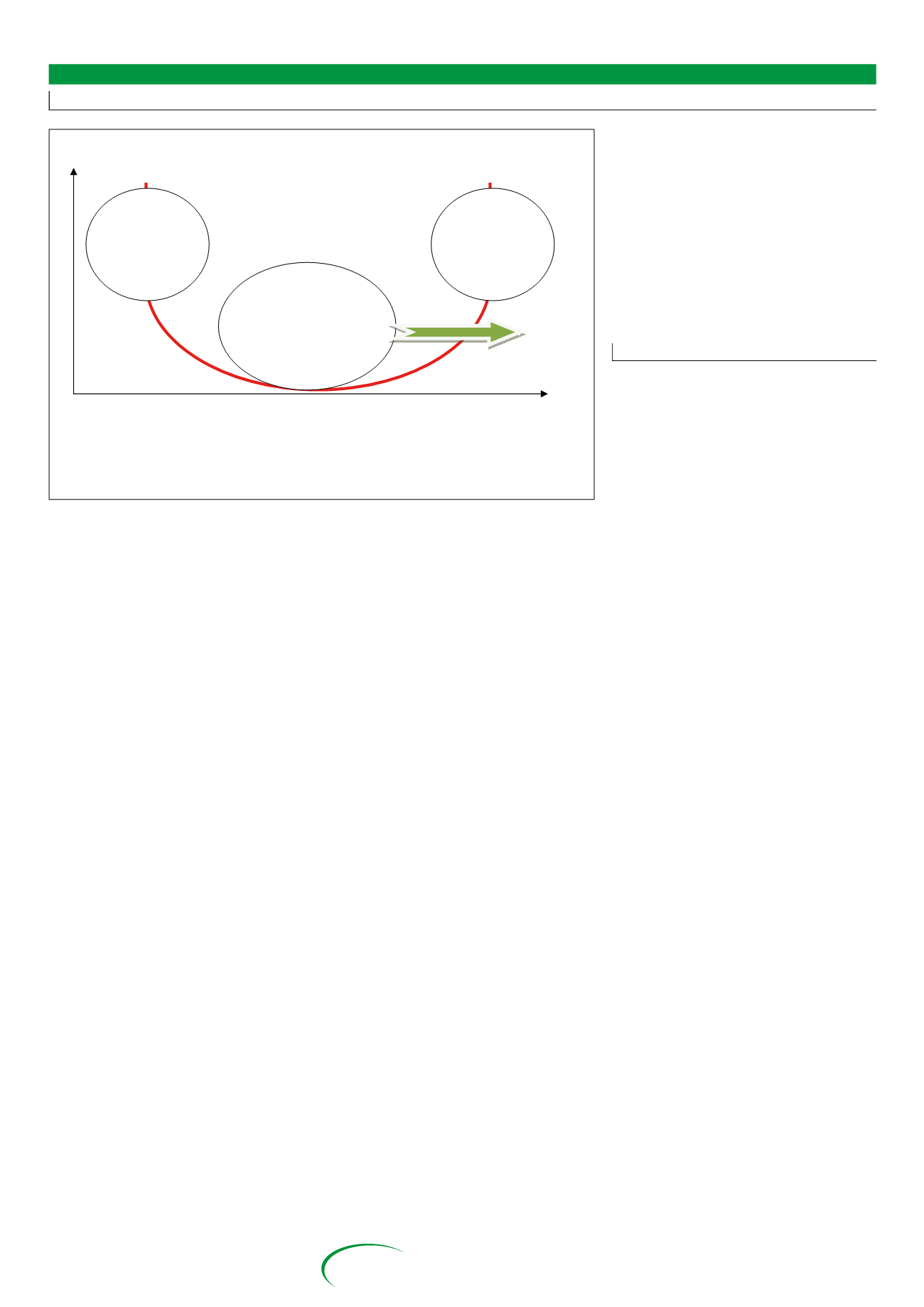
Fachbereiche
Schimmelpilze
stungen, die nur bei der Sanierung oder in be-
stimmten Arbeitsbereichen auftreten können,
können schwere Erkrankungen wie die EAA oder
als leichtere Form die MMI auftreten. Dazwi-
schen sind keine Gesetzmäßigkeiten erkennbar
und somit auch keine Grenzwerte vorgegeben.
Wie soll jetzt eine potentielle gesundheitliche
Beeinträchtigung erfasst und bewertet werden?
Dabei ist es sinnvoll, sich den Begriff der
Gefährdung genauer anzusehen. Rechtlich ange-
siedelt, liegt die Gefährdung zwischen den Begrif-
fen Sicherheit und Gefahr.
Sicherheit
bezeichnet
einen Zustand, der frei von unvertretbaren Ri-
siken angesehen wird.
Gefahr
ist ein Zustand oder
Ereignis, bei dem ein nicht akzeptables Risiko
vorliegt und somit die hohe Wahrscheinlichkeit
eines Schadenseintritts besteht. Eine
Gefährdung
ist demzufolge der Bereich zwischen Schadens-
freiheit und Schadenseintritt. Eine Gefährdung
ist ein Zustand oder eine Situation, in der die
Möglichkeit des Eintritts eines Gesundheitsscha-
dens besteht und entsteht durch ein mögliches
räumliches und/oder zeitliches Zusammentreffen
eines verletzungs- bzw. krankheitsbewirkenden
Faktors einer Gefahrquelle.
Gefährdung ist ein
Zustand erhöhter Aufmerksamkeit.
Ohne Verharm-
losung, ohne Panikmache. Und das ist genau die
passende Definition für die Bewertung von ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen bei Schim-
melschäden und deren Sanierung im Innenraum.
Zusammengefasst können wir im Rahmen ei-
ner Bewertung der Gesundheitsgefährdung von
Schimmelpilzen, Bakterien und anderen Begleit-
organismen festhalten, dass für Normalgesunde,
Schwangere und Kleinkinder ein Infektionsrisi-
ko nahezu ausgeschlossen werden kann. Auch
ist es unwahrscheinlich, dass Mykotoxine aus
Befallsherden freigesetzt werden und zu Beein-
trächtigungen führen. Daher ist es im Rahmen
einer Gefährdungsbeurteilung auch nicht not-
wendig oder sinnvoll, Gattungsbestimmungen
oder Toxinanalysen vornehmen zu lassen. Es ist
auch nicht zielführend, in diesem Zusammenhang
für den Nichtgefährdeten lange Dossiers über
Mikroorganismen und ihre Toxine zu erstellen,
die verunsichern, obwohl die Normalbevölkerung
nicht davon betroffen ist.
Anders bei der Risikogruppe der Immunsup-
primierten, deren Infektionsrisiko tatsächlich
stark erhöht ist. Hier sind Gattungsbestimmungen
sinnvoll, da das Infektionsrisiko und auch der
Verlauf der Infektion von der Gattung abhängig
sind. Dabei sind insbesondere bei Aspergillus-
Infektionen schlechte Prognosen zu erwarten.
Eine Bewertung durch den Sanierer oder Bau-
sachverständigen scheidet aber zumeist aus, da
hier die medizinische Betreuung sehr engma-
schig ist und hier frühzeitig der behandelnde
Arzt eingreifen dürfte (8).
Doch wie sieht die Bewertung in Richtung
sensibilisierende und allergisierende Wirkungen
aus? Da generell alle Schimmelpilze sensibilisie-
rend wirken können, kann auch hier eine ver-
allgemeinerte Formulierung angesetzt werden.
Gattungsbestimmungen sind nicht notwendig.
Da in keiner Weise abgeschätzt werden kann, ob
und wann es zum auslösenden Erstkontakt, also
zum Manifestieren der falschen Immunantwort
kommt, muss unter dem Blickwinkel der erhöh-
ten Aufmerksamkeit davon ausgegangen werden,
dass jederzeit in schimmelbelasteten Innenräu-
men dieser Erstkontakt stattfinden kann, was
durch Studien zumindest tendenziell bestätigt
wird. Hieraus leitet sich der Vorsorgegedanke
ab, dass Schimmelpilzbefall im Innenraum nicht
zu tolerieren ist und präventiv entfernt werden
sollte. Und zwar wiederum unabhängig von Gat-
tung und Toxinproduktion.
Anders kann es sich bei bereits diagnosti-
zierten Schimmelpilzallergikern verhalten, hier
kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob relevante
Pilzgattungen und/ oder ihre Allergene nachge-
wiesen werden können, um Maßnahmen besser
planen zu können.
Wer es mit der erhöhten Aufmerksamkeit kei-
nesfalls auf die leichte Schulter nehmen sollte, ist
der Ausführende. Gerade bzw. fast ausschließlich
bei der Sanierung werden derart hohe Sporen-
konzentrationen freigesetzt, die ohne Arbeits-
schutzmaßnahmen zu ernsthaften Erkrankungen
wie EAA und ODTS führen können (9).
Literatur
1. RKI: Erste Ergebnisse der KiGGS-Studie zur Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.
RKI, Berlin 2006.
2. RKI: Empfehlung des Robert Koch-Instituts: Schim-
melpilzbelastung in Innenräumen – Befunderhebung,
gesundheitliche Bewertung und Maßnahmen, 2007,
Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforsch Gesund-
heitsschutz 50:1308–1323.
3. WHO guidelines for indoor air qualitiy: dampness
and mould. Hrsg.: World Health Organization (WHO),
Kopenhagen 2009.
4. Bartram FA: Schimmelpilzexpositionen in lnnenräu-
men als (Mit-)Ursache umweltmedizinischer Erkran-
kungen, umwelt.medizin.gesellschaft | 23 | 3 /2010.
5. KRINKO – Kommission für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut
(RKI): Anforderungen an die Hygiene bei der medi-
zinischen Versorgung von immunsupprimierten Pa-
tienten. Bundesgesundheitsbl 2010 53: 357–388.
6. Wiesmüller GA, Szewzyk R, Gabrio Th, Engelhart St,
Heinz WJ, Cornely OA, Seidl HP, Fischer G, Herr CEW:
Häufige Fragestellungen in Zusammenhang mit der
Bewertung eines möglichen Infektionsrisikos von
Schimmelpilzexpositionen: Antworten eines Round
Table auf dem Workshop „Schimmelpilze und schwere
Grunderkrankungen – welches Risiko ist damit ver-
bunden?“ im Rahmen der GHUP-Jahrestagung 2009.
Umweltmed. Forsch. Prax. 2010, 15: 104–110.
7. Wiesmüller GA, Szewzyk R, Gabrio Th, Fischer G, Licht-
necker H, Merget R, Ochmann U, Nowak D, Schultze-
Werninghaus G, Steiß J-O, Herr CEW: Häufige Fra-
gestellungen in Zusammenhang mit der Bewertung
eines möglichen allergischen Risikos von Schim-
melpilzexpositionen: Antworten eines Round Table
auf dem Workshop “Schimmelpilze und allergische
Erkrankungen” im Rahmen der GHUP-Jahrestagung
2010. Umweltmed. Forsch. Prax. 16: 98–106.
8. Exner M, Engelhart S, Gebel J, Ilschner C, Pfeifer R,
Höller C, Dilloo D, Maschmeyer G, Simon A: Hygiene-
Tipps für immunsupprimierte Patienten zur Vermei-
dung übertragbarer Infektionskrankheiten, HygMed
2011; 36 [1/2]: 36–44.
9. Beschluss 45/2011 des ABAS vom 05.12.2011: Stel-
lungnahme „Kriterien zur Auswahl der PSA bei Ge-
fährdungen durch biologische Arbeitsstoffe“.
10. Langen U: Sensibilisierungsstatus bei Kindern und
Jugendlichen mit Heuschnupfen und anderen ato-
pischen Erkrankungen, Ergebnisse aus dem Kinder-
und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) Bundesge-
sundheitsbl 2012, 55:318–328.
11. Wiesmüller GA, Szewzyk R, Gabrio Th, Baschien C,
Fischer G, Heinzow B, Raulf-Heimsoth M, Herr CEW
(2011): Häufige Fragestellungen in Zusammenhang
mit der Bewertungmöglicher toxischer Reaktionen
von Schimmelpilzexpositionen: Antworten eines
Round Table auf dem Workshop „Schimmelpilze
und toxische Reaktionen” im Rahmen der GHUP-
Jahrestagung 2011, Umweltmed. Forsch. Prax. 17
(3) 2012: 159–169.
Bild 2: Schema zur Bewertung möglicher Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Schimmelpilze in Abhängigkeit
von der Aktivität des Immunsystems.
Schützen & Erhalten · September 2015 · Seite 28
Zustand des Immunsystems
supprimiert kompetent immunisiert
Risiko einer Erkrankung
Infektion
keine
Infektionsgefahr
mögliche
Sensibilisierung
Allergie
EAA